Aus dem
Werdegang des Ahrtals
Beobachtungen
zur Geologie von Tal und Rahmenlandschaft
Dr. Bruno P. Kremer
Das Rheinische
Schiefergebirge ist sicherlich eine der interessantesten Mittelgebirgsregionen.
Vor allem sein Nordwestflügel, die Eifel, zieht seit langem die Aufmerksamkeit
der Geowissenschaftler auf sich, weil sich hier die oberflächenformenden
Kräfte und Vorgänge aus nahezu 400 Millionen Jahren Erdgeschichte besonders
klar verfolgen lassen. Immerhin gehören die in der Eifel zugänglichen
Schichtgesteine zu den ältesten in Mitteleuropa aufgeschlossenen Materialien.
Darüber hinaus besticht gerade an der Eifel die geologische Vielgestaltigkeit,
die in keinem anderen Teilgebiet des Rheinischen Schiefergebirges in
vergleichbarem Maße in Erscheinung tritt. Zwei vulkanische Ausbruchswellen, die
sich etwa um 40 -35 Millionen Jahren bzw. 500 000 -11 000 Jahren vor der
Gegenwart ereigneten, haben drei prägnante Vulkanfelder geschaffen: In der
West-, der Hoch- und der Osteifel, dem rund 1 500 Quadratkilometer großen
Gebiet der Vulkaneifel, haben die beiden zeitlich
weit getrennten Förderphasen mehrere hundert Ausbruchspunkte hinterlassen. Der
vulkanische Formenschatz mit seinen vielen verschiedenen Förderprodukten und
seinen Schloten, Schlackenkegeln und Kuppen trägt erheblich zur Belebung des
Landschaftsbildes bei. Strenggenommen ist die Eifel
nicht einmal ein Bergland. Zwar bestimmen der Abwechslungsreichtum des Reliefs
und durchaus respektable Unterschiede in der Höhenstufenverteilung den Landschaftseindruck
auf weiten Strecken, doch entsteht das Bild einer Gebirgsregion fast immer nur
aus dem Blickwinkel der zahlreichen und zumeist tief eingeschnittenen Täler.
Der wirkliche Charakter der Eifellandschaft zeigt sich im Grunde genommen erst,
wenn man auf die Höhen hinaufsteigt und das Gelände gleichsam von erhobener
Warte überblickt.
Von diesem
Blickpunkt aus präsentiert sich die Eifel größtenteils als ein weites,
gelegentlich sanft wellig geschwungenes Hochflächengebiet. Nur in Richtung der
größeren begrenzenden Flußläufe und eben auch in der
Nachbarschaft der Ahr werden die sonst so geschlossen
erscheinenden Eifelhochflächen durch Zertalung
zerschlitzt und stärker aufgelöst. Von der Hohen Acht oder vergleichbaren
Aussichtsbergen aus ist das Netz der eingetieften Talzüge gut erkennbar. Aus der Hochlandregion des Hohe-Acht-Berglandes streben die zunächst noch
muldenförmigen, nach kurzer Entfernung aber schon sehr engen und tiefen Talzüge wie die Speichen eines Rades nach allen Seiten
auseinander.
Im Gewässernetz
der Eifel nimmt die Ahr eine sehr zentrale Stellung
ein. Der größte Teil dieser Mittelgebirgsregion wird über große Bäche und
kleine Flüsse zur Mosel entwässert, die Ahr ist der
einzige bedeutendere Rheinzufluß aus der gesamten
östlichen Eifel. Auf rechtsrheinischem Gebiet sind die Fließgewässer im
Vergleich zum Eifelraum sehr viel dichter angeordnet. Diese Tatsache geht auf
die unterschiedliche räumliche Verteilung der jährlichen Niederschlagsmengen
auf beiden Flügeln des Schiefergebirgsblock zurück. Die östliche Eifel befindet
sich deutlich im Regenschatten von Ardennen, Hohem Venn
und westlicher Hoch-eifel. Diese Hochregionen lassen
die von Westen herangeführten feuchten Luftmassen bereits in den Randgebieten
abregnen. Im größten Teil des Einzugsgebietes der Ahr
fallen weniger als 700 mm Niederschläge pro Jahr. Im rechtsrheinischen
Schiefergebirge stellen sich die Verhältnisse dagegen etwas anders dar. Hier
werden die vom nordwestdeutschen Tiefland heranziehenden Luftmassen erstmals
von den Schiefergebirgshöhen zum Aufsteigen und daher zum Abregnen gezwungen. Auf weiten
Teilen des rechtsrheinischen Schieferge-birgsflügels
fallen jährlich mehr als 1 000 mm Niederschläge. Sayn,
Wied, Agger, Sieg oder Wupper sind daher ganzjährig
wasserreicher als die Ahr.
Dennoch hat die
Ahr den alten Schiefergebirgsrumpf tief
durchschnitten, wie sich beim Vergleich der Talmorphologie
im Ober-, Mittel-und Unterlauf eindrucksvoll
bestätigt. In ihrem obersten Abschnitt verläuft die Ahr
ziemlich geradlinig von NW nach SO, wobei die vielen kleinen Mäander, die in
der 100 -130 m breiten Wiesensohle pendeln, die Hauptabflußrichtung
kaum bestimmen. Bei Ahrhütte treten in 500 -520 m ü.
NN erstmals die Höhenfluren der Eifelrumpffläche an das Ahrtal
heran. Dennoch bleibt das oberste Talstück insgesamt
recht breit und noch wenig eingetieft. Bei Ahrdorf biegt das Ahrtal nahezu
rechtwinklig in eine nordöstliche Abflußrichtung um
und tritt dabei aus dem Kalkmuldengebiet endgültig in die unterdevonische
Schiefer- und Grauwak-kenzone über. Das Talbild gestaltet sich jetzt wesentlich formenreicher.
Zwischen Ahrdorf und Müsch
beschreibt das Tal zwei besonders enge Talmäander, in
denen die Breite der Talsohle bis auf etwa 50 m verschmälert wird, während sie
sonst im Durchschnitt 100 -150 m beträgt. Bis Antweiler ist der Talzug in breite Trogböden eingetieft,
die in etwa 400 - 420 m ü. NN anstehen. Unterhalb Antweiler ziehen wieder die
alten Rumpfflächen der Eifel unmittelbar bis an den Taleinschnitt
heran. Hier ragen die Talflanken bereits um über 230
m auf. Die zweifellos markanteste landschaftliche Erscheinung in diesem
Teilabschnitt ist der Arem-berg, der sich rund 120 m
über die Eifelrumpffläche und nahezu 360 m über die Talsohle des Ahrtals erhebt.
Ahrabwärts beginnt bei Schuld ein Talabschnitt,
der durch auffallende Mäanderbildungen gekennzeichnet ist. Diese
erste, bis etwa nach Insul reichende Mäanderstrecke
unterscheidet sich jedoch noch deutlich vom eigentlichen Engtalabschnitt
der Ahr, weil die einzelnen Schlingen wegen der noch
geringen Wasserführung des Flusses keine allzu großen Schwingungsweiten
erreichen und daher auch viel weitständiger angeordnet sind. Dennoch zeigt sich auch hier
bereits eindrucksvoll der stetige Wechsel von Prall- und Gleithängen. In den
Gleitmäandern schwankt die Talbreite zwischen 50 und
200 m. Unterhalb von Insul, in einem von
der allgemeinen Abflußrichtung abweichenden Talabschnitt, erreicht der Talboden
dagegen um 500 m Breite. Bei Insul findet sich
außerdem eine interessante Weiterentwicklung eines Mäanders: Ein von der Ahr ursprünglich umflossener Bergsporn wurde durch die
Erosionskraft des fließenden Wassers allmählich abgetrennt. Dadurch verkürzte
sich der Bogen, weil der Fluß nunmehr den kürzeren
Weg nahm. Der abgelöste Bergsporn ist noch vorhanden und bildet einen markanten
Umlaufberg.
Nach der
Aufnahme des Adenauer Baches, der im Kartenbild fast als die natürliche
Fortsetzung des Ahrteils erscheint (ein Eindruck, den
die Verkehrslinienführung noch unterstützt), schließt sich ein ausgeprägter Kerbtalabschnitt mit Talsohlenbreiten um etwa 200 - 300 m
Breite an. Zwischen Henningen und Pützfeld drängen schuttreiche Bäche die Ahr immer wieder etwas zur Seite. Von zwei größeren Talbögen bei Pützfeld abgesehen, behält der Fluß seine vorgezeichnete, ziemlich gerade Abflußrichtung bei. In diesem Bereich liegt das Ahrtal in vergleichsweise weichen, der Verwitterung eher
zugänglichen Schichten. Starke Hangversteilungen fehlen daher in diesem Talabschnitt. Die Talflanken sind
daher auch viel sanfter geneigt als im nachfolgenden Engtalabschnitt
unterhalb von Kreuzberg. Bis zu diesem
Wechsel in der Talszenerie bleibt das umgebende Hochflächenniveau bei etwa
400 m ü. NN. Auf nur 29 km Fließstrecke von Müsch bis
Kreuzberg fällt die Talsohle der Ahr von rund 300 m
auf 170 m ü. NN. Somit hat die Ahr ihren Einschnitt
in das umrahmende Schiefergebirge von annähernd 100 m auf über 200 m vertieft.
Auf der anschließenden Engtalstrecke zwischen
Kreuzberg und Walporzheim nimmt die Tiefe des Taleinschnittes noch einmal um rund 100 m zu. Schon allein
daraus ergibt sich die erhebliche Reliefenergie selbst eines kleineren
Fließgewässers auf kurze Entfernung. Die Engtalstrecke,
die ungefähr mit dem Weinbaugebiet an der Ahr
zusammenfällt, ist die landschaftlich eindrucksvollste Teilregion des Ahr-gebiets. Ernst Moritz Arndt hat zweifellos recht
gesehen, als er 1844 schrieb, daß das »Wundersamste .. die Schlingungen des Flusses um und durch die
Felsenmauern seien«. Bei Dernau biegt die Ahr, von Rech fast geradlinig nach Norden abfließend,
wiederum rechtwinklig in den geradlinig nach Osten gerichteten Lauf des unteren
Talabschnittes um. Diese Fortsetzung des Engtalabschnitts erscheint fast so selbstverständlich, daß sich die Suche nach einer anderen Abflußrichtung
beinahe überhaupt nicht stellt. Näheren Aufschluß
gibt jedoch ein Blick vom Krauseberg bei Dernau nach
Norden. Oberhalb von Dernau tritt die Wasserscheide
zwischen Ahr und Swist bis
auf fast 1 000 m Distanz an die Talflanke des Ahrtales heran.
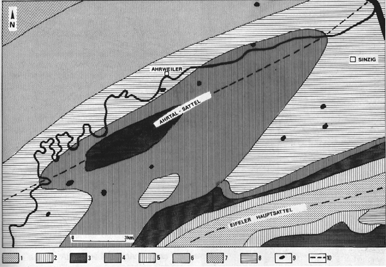
Vereinfachte geologische Karte des mittleren und
unteren Ahrtals. Die verschiedenen Schraffuren
bedeuten: Untersiegen, 1 = Sandsteinfolge, 2 = Tonschiefer; Unteres
Mittel-Siegen, 3 = Sandstein, 4 = Tonschiefer; 5 = Oberes
Mittel-Siegen (Sandstein); 6 = Obersiegen (Ton-, Schluff-
und Sandsteine); 7 = Unterems; 8 = Tertiär; 9 = basaltische
Vulkane; 10 = Sattelachse
Zeichnungen: Kremer
An dieser
Stelle fällt am oberen nördlichen Rand des Ahrsteiltals
eine etwa 600 m breite, nicht allzu markante Eintiefung
auf, die genau das Aussehen eines Spülmuldental-Querschnitts
aufweist. Dieser Talflankeneinschnitt fällt in
nördlicher Richtung ziemlich flach zur oberen Swistbachaue
ab. Diese für den heutigen Swistbach unverständlich
breite Spülmulde ist mit großer Wahrscheinlichkeit die ursprünglich geradlinige
Fortsetzung des Ahrtals nach Norden. An den heutigen
Reliefeigenschaften des Geländes kann man noch deutlich ablesen, wie das von
Süden heranziehende alte Ahrtal sich über die heutige
Wasserscheide fortsetzt und der Niederrheinischen Bucht unter Umgehung des
Mittelrheins zustrebt. Folglich sind die heutigen drei Quelläste
der Swist ursprünglich in die Ahr
geflossen, und der derzeitige Swist-Erft-Graben ist
ein alt angelegtes Ahrtal.
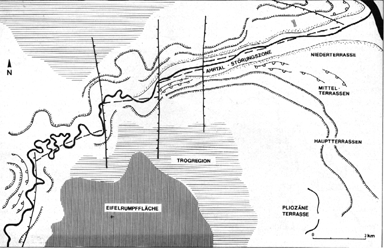
Reliefgenerationen und Talterrassen
im mittleren und unteren Ahrtal
Erst vor
rund zwei Millionen Jahren führten Bewegungen an verschiedenen Störlinien im
Bereich des heutigen Ahrtals dazu, daß der Fluß den unteren Talbereich ausräumen und dem Mittelrhein zueilen konnte.
Auf ihrem Weg aus dem Kalkmuldengebiet um Blankenheim durch die devonischen
Schiefergesteine bis in die Linz-Remagener Mittelrhein-Talweitung
hat die Ahr auf weiten Strecken das anstehende
Gestein angeschnitten und so freigelegt, daß sich ein
hervorragender Einblick in den Aufbau des nordwestlichen Schieferge-birgsflügels
ergibt. Dieser im Ahr-Engtal an vielen Stellen der
Beobachtung zugängliche Schiefergebirgssockel wird von Gesteinsfolgen des
Unterdevons aufgebaut, die während der Karbonzeit zum variskischen
Faltengebirge zusammengeschoben wurden. Die Falten in
den Gesteinspaketen und die mit ihnen entstandenen Schieferflächen und
Überschiebungen sind im Umkreis des Ahrtals wie im
gesamten übrigen Schiefergebirge recht genau in NO/SW-Richtung angeordnet.
Gerade in der östlichen Eifel ist ein genauerer Einblick in den Faltenbau des
Gebirges möglich.
Die den Rahmen
des mittleren und unteren Ahrtals aufbauenden
Gesteine gehören zu den Siegener Schichten aus dem unteren Devon. Sie sind
älter als 350 Millionen Jahre. In der Osteifel und im benachbarten Westerwald
bilden sie ein ausgedehntes Faltenbündel, das sich auf die beiden Großsättel
verteilt, die in der regionalen Geologie als Ahrtal-Sattel
und als Eifeler Hauptsattel (= Sattel von Hönningen-Seifen) bezeichne} werden. Die Kernzone des Ahrtal-Sattels kreuzt das Rheintal zwischen Linz und Kasbach. Seine rechtsrheinische Fortsetzung ist bisher noch
weitgehend unbekannt. Der Eifeler Hauptsattel quert
das Mittelrheingebiet zwischen Bad Breisig und Bad Hönningen
und zieht über Waldorf, Oberdürenbach, Cassel bis in die Gegend nördlich von Adenau, wo sich der
Großsattel in eine ziemlich flachwellige Struktur auflöst.
Die Achsen der
einzelnen Gesteinsfalten liegen innerhalb der Aufsattelung nicht exakt
horizontal, sondern bilden in der östlichen Eitel eine ausgedehnte Kuppel, eine
Achsenkulmination. Am Mittelrhein und im rechtsrheinischen Schiefergebirge
tauchen sie nach NO ab. Westlich der Achsenkulmination, die sich etwa mit der
Linie Rheinbach - Kempenich -Ettringen festlegen läßt, tauchen die Faltenachsen hingegen in südwestlicher
Richtung ab. Der Ahrtal-Sattel besteht in seinem Kern
aus einer ziemlich monotonen Sandsteinfolge (Grauwacke)
des unteren Mittelsiegen, die randlich
von ebenso gleichförmigem Tongestein begleitet wird. Von SO und NW schiebt sich
in den Sattelbereich eine Sandsteinserie des oberen Mittelsiegen vor. Gerade an
der Nordflanke des Ahrtal-Sattels sind die
Gesteinsschichten des oberen Mittelsiegen auffallend steil gestellt.
Stellenweise ragen die Schichtflächen sogar senkrecht auf. Bei Altenahr, am
Ausgang des Langfig-Tals unmittelbar vor dem Straßentunnel
durch den Mäanderhals, lassen sich sogar bemerkenswerte Hinweise auf die
Absatzbedingungen dieser Gesteine finden: Die steil aufgerichteten
Schichtflächen sind von einem dichten Netz fossiler Wellenfurchen oder Rippelmarken überzogen. Zur Entstehungszeit der
betreffenden Gesteinslagen war unser Gebiet von einem vergleichsweise flachen
Meer bedeckt. Die Spuren, die sich in Gestalt der Furchenmuster über nahezu 400
Millionen Jahre hinweg erhalten haben, sind nichts anderes als ein fossiler Wattboden.
Andere Hinweise auf das Devonmeer finden sich innerhalb der Gesteinspakete in
Form verschiedener tierischer Fossilien (Muscheln, Brachiopoden,
Haarsterne), die für Meeresgebiete mit Flach- oder Seichtwasserbiotopen typisch
sind.
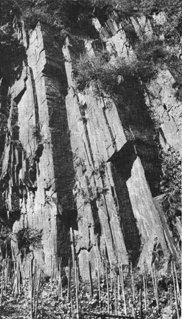
In der Engtalstrecke
des Ahnais sind die Sandsteine des Mittelsiegen stellenweise senkrecht
aufgerichtet
Wenn man etwa
von Rech aus das Ahrtal aufwärts wandert oder fährt,
gelangt man aus dem Sattelkern des Ahrtal-Sattels mit
seinen Gesteinen des unteren Mittelsiegen in immer jüngere Gesteinsfolgen.
Zwischen Mayschoß und Altenahr sind die Schleifen der Ahr
fast ausschließlich im oberen Mittelsiegen angelegt. In der Umgebung von Schuld
steht in den Talflanken Oberes Siegen an, und bei Müsch sowie im unteren Trierbach-Tal sind die grauen
Schiefergesteine des Unterems (= Stadtfeld-Schichten) aufgeschlossen. Nur wenig
ahrauf-wärts steht mit den bunten Klerf-Schichten
noch höheres Unterdevon an, bis bei Dorsel und Ahrdorf schließlich die Kalke und Mergel der Ahrdorfer Mitteldevonmulde erreicht sind. Die
Faltenstrukturen, die die großräumige Aufsattelung im Ahrtal-Sattel
zusammensetzen, sind an mehreren Stellen der Beobachtung zugänglich. Besonders
klar ist eine sehr engständige Gesteinsfalte in der Ravenlay
bei Rei-merzhoven zu erkennen. Größere Berühmtheit
unter den Geologen weist jedoch die Falten-Struktur in der Umgebung von Schuld
auf. Hier hat die Ahr in den steilen Talwänden gleich mehrfach Profilschnitte durch die gleiche
Faltenstruktur gelegt, die hier dem Obersiegen zuzuordnen ist. An diesem Faltenaufschluß wurden von dem Bonner Geologen H. Cloos grundlegende Untersuchungen über die Vorgänge bei der
Auffaltung eines Gesteinspaketes durchgeführt. Besonders eindrucksvoll sind die
Schichten am Westhang des Rupenberges erkennbar, vor
allem im Winterhalbjahr, wenn keine Belaubung den Blick auf das Gefüge
verstellt. Bei der Rupenbergfalte fällt die
ausgesprochene Asymmetrie ins Auge: Während der Südostflügel der Falte ziemlich
flach einfällt und langgezogen erscheint, ist der
Nordwestflügel recht kurz und entsprechend steil. Gegenüber der Ahrbrücke an der Straße von Schuld nach Fuchshofen
kann man sehen, wie der flache Faltenschenkel in einer großen Mulde wieder
umbiegt. Die zugehörige Falte ist nicht erhalten. Wo sie ursprünglich anstand,
erstreckt sich heute die Talaue der Ahr. Der tief in das Rahmengebirge eingeschnittene Talzug der Ahr ist das Ergebnis
der Seiten- und Tiefenerosion des fließenden Wassers. An den Oberflächenformen
des heutigen Tals ist di< jüngere geologische Geschichte der Eintiefun; recht vollständig abzulesen. Wichtige Zeitmar ken der Talgeschichte sind die verschiedener
Terrassenzüge, die an den heutigen Talflanker
auffindbar sind. Es sind ehemalige Talböden in die
die Ahr sich im Laufe der Zeit immer tiefe
eingeschnitten hat. Die einzelnen Terrassen körper
stellen Stillstandsphasen der Tiefenero sion dar: Während der verschiedenen Eiszei
ten führte der Fluß weniger Wasser und schot terte dabei kräftig auf. In
den jeweiligen Warm zeiten floß
das Wasser reichlicher. Dabei wur de der Talboden teilweise wieder ausgeräum
und ein neues Bett eingeschnitten. Seitwärt! am Talhang bleibt der Talbodenrest
in Forrr einer schmalen oder breiteren Leiste stehen.
In der Linz-Remagener Rheintalweitung sine alle bekannten ehemaligen Talböden des Mit telrheins in
Form eines kompletten Terrassen Stufensystems erhalten. Im Bereich der Ahr mündung biegen diese
Terrassen in die jeweiligen alten Talböden der Ahr um. Die jüngerer Glieder dieser Terrassenfolge sind naturgemäf besser erhalten und im Gelände zu Verfolger als
die alten Terrassen, mit denen die Talent Wicklung vor über zwei Millionen
Jahren über haupt erst begann. Von der Mündung bis
nach Walporzheim sowie zwischen Dernau
unc Rech läßt sich
beispielsweise die Niederterrasse (etwa 4 m über der Ahr)
gut ausgliedern Zusammen mit dem Hochflutbett nimmt sie fasl
die gesamte heutige Talaue ein. Im mittlerer
Ahrtal tritt sie kaum in Erscheinung. Erst
oberhalb von Insul ist sie wieder in größerer
Ausdehnung anzutreffen.

Blockbild der Umgebung von Schuld. An den Talflanken ist ein Faltenzug aus dem Ahrtal-Sattel
mehrfach angeschnitten. (Umgezeichnet nach W. Meyer 1983)
Von der Ahrmündung bis fast nach Müsch
lassen sich zwei weitere alte Talböden
rekonstruieren, die zur Ahr einen Höhenabstand von
knapp 20 m bzw. etwa 60 m aufweisen und als Mittelterrassen bezeichnet werden.
Sie stammen aus der Riß- bzw. der Mindel-Eiszeit.
Ofl sind diese Gehängeterrassen nur in kleineren, unzusammenhängenden Teilstücken erhalten. Besonders
prägnant tritt die obere Mittelterrasse etwa unterhalb von Ahrweiler bei Ehlingen in Erscheinungen, wo sie sogar auf der rechten
Seite eine Talverengung bildet.
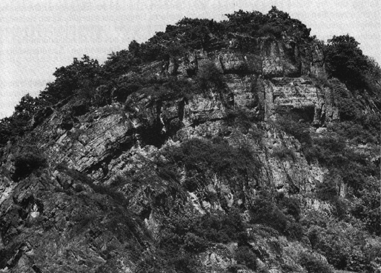
An mehreren Stellen hat die Ahr
bei der Eintiefung Profilanschnitte geschaffen, an
denen die Faltenstruktur des Grundgebirges sichtbar wird
Fotos: Kreisbildstelle
Die jüngere (=
untere) Hauptterrasse der Ahr geht bei Sinzig in die
entsprechende Terrassenstufe des Mittelrheins über. Ihre Oberkante liegt
entsprechend bei ungefähr 200 m ü. NN. Nochmals etwa 40 m darüber setzt
zwischen Rech und Mayschoß die obere (= ältere) Hauptterrasse ein. Beide
Terrassenstufen sind in größeren Teilstücken als Gehänge- bzw. Flurterrassen
bis in den Oberlauf der Ahr klar zu verfolgen. Sie
sind die Hinterlassenschaft der frühquartären
Eiszeiten. Die untere Hauptterrasse liegt bei Bad Neuenahr auf der rechten Ahrtalseite eigenartigerweise etwa 30 m höher als auf der
Nordflanke des Tals. Darin drücken sich jüngere Störungen des Gebiets aus. Das
gesamte untere Ahrtal wird von einer größeren Störung
oder Bruchlinie durchzogen, an der entlang die beiden Talseiten eine
unterschiedliche Hebung erfuhren. Die gesamte Nordflanke wurde seit dem
mittleren Quartär offenbar etwas stärker nach Norden abgekippt, denn zwischen
Rech und Pützfeld fällt die Hauptterrassenfläche viel weniger zum Tal ab, als
es bei anderen Terrassen dieser Altersstellung der Fall ist. Diese lebhaften
Bewegungen innerhalb des Schiefergebirges, die nach einer ersten tertiären
Welle besonders im Quartär wirksam wurden, dauern bis in die Gegenwart an. In
manchen Teilregionen des nordwestlichen Schiefergebirgsflügels werden größere
Blockeinheiten jährlich sogar um Millimeterbeträge gegeneinander versetzt.
Solche Hebungsvorgänge im Grundgebirge waren in der Vergangenheit jeweils mit
ereignisreichem Vulkanismus gekoppelt. Im Tertiär entstand das Vulkangebiet der
Hocheifel, das vom Ahrtal randlich durchschnitten wird. Der Talzug
der Ahr bildet dabei gleichzeitig die Grenze zwischen
dem Hocheifel- und dem Siebengebirgsvulkanismus, der
nicht nur auf die rechte Rheinseite oder den rheinnahen Westerwald beschränkt
blieb, sondern auch einige Fundpunkte etwa im Bereich der Gemeinde Grafschaft
hinterließ. Ähnlich ist auch der quartäre Vulkanismus der Osteifel nicht nur im
engeren Umkreis des Laacher Sees lokalisiert. Er
griff nämlich auch nach Norden weit über das Ahrtal
hinaus, denn sein nördlichster Fundpunkt ist der Rodderberg
bei Bonn, von dem etwa ein Viertel noch zum Landkreis Ahrweiler gehört.
Bei näherem
Hinsehen erweist sich Tallandschaft der Ahr ebenso
wie ihr näheres und weiteres Umland als eine geologisch vielseitige und
interessante Region, in der sich manche wichtige Phase aus der Oberflächenge des heutigen Rheinischen Schiefergebirges
beispielhaft aufspüren läßt.
Eine
ausführlichere Landschaftsbeschreibung und ergänzende Angaben zur
Originalliteratur über die Ahrregion ist in den
beiden Schriften »Das Ahrtal« (= Rheinische Landschschaften, H. 23, Neuss 1982) und »Der Mittelrhein«
(= Rheinische Landschaften, H. 26, Neuss enthalten.